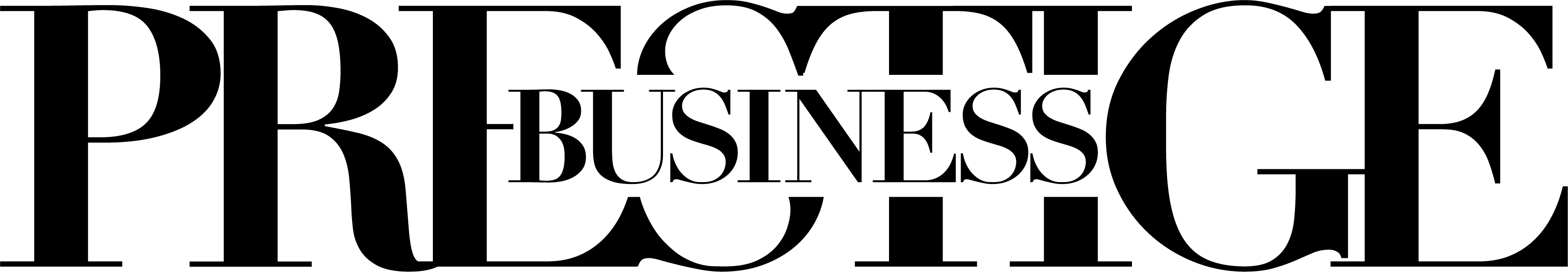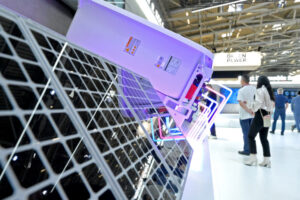Herr Gassler, was ist Palliative Care?
Hier im Palliativzentrum Hildegard betreuen wir schwerkranke Menschen, für die leider keine Heilung mehr zu erwarten ist. Für diese Personen ist es ganz wichtig, dass sie nicht unnötig unter Schmerzen leiden, dass sie sich nicht über Atemnot beklagen müssen oder sogar mit Angstzuständen zu kämpfen haben. Wir kümmern uns natürlich auch um die Aspekte der Psyche, um Fragestellungen, die ins Soziale hineingehen, aber auch um spirituelle Anliegen.
Sie sind seit April 2015 Direktor dieser Klinik. Was konnten Sie während dieser Zeit bewegen?
Ich habe hier ein Team von Fachleuten angetroffen, die alle Experten sind auf ihrem Gebiet. Alle top motiviert und engagiert. Damit dieses Team noch besser zusammenarbeiten kann, haben wir begonnen, die Infrastruktur und die Prozesse in der täglichen Arbeit zu verbessern, zum Beispiel keine langen Wege, keine langen Suchen nach etwas. Und dies in einem organisierten kontinuierlichen Verbesserungsprozess, an dem alle mitbeteiligt sind. Der erste Schritt ist zu prüfen, wo gibt es Verschwendung, Doppelspurigkeiten, verstellten Platz, und wenn diese Unebenheiten behoben sind, kann man sich den Prozessen widmen und Standards überprüfen oder neu definieren. Die Verantwortung liegt dann in der Hand der Mitarbeitenden. Wir unterstützen sie dabei. Die kontinuierliche Verbesserung ist für alle ein dauernder Lernprozess. Dazu gehören Wissen – Können – Wollen – Dürfen. Dem Dürfen messen wir besondere Bedeutung bei. Die Leute bekommen mehr Kompetenz und können ihre Fähigkeiten noch besser einsetzen. Besonders achten wir auch auf die Balance im Wohlergehen. Den Patienten wie auch den Pflegenden muss es gut gehen. Unsere Mitarbeitenden arbeiten ja mit schwerkranken, traurigen und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen und sind dadurch sehr gefordert. Und unsere Leute wissen auch: Sobald es eine Tätigkeit gibt, die man nicht alleine ausführen kann – gemeinsam geht es besser. Das ist für mich der Sinn eines Unternehmens: die Gemeinsamkeit.
Wie sehen Sie hier Ihre Führungsaufgabe?
Das Erste ist Zusammenarbeit organisieren, die nicht von alleine entsteht. Die Verteilung der Aufgaben in der Zusammenarbeit ist Führungsarbeit. Der zweite Punkt ist: Ich muss die Mannschaft zusammenschweissen. Erst wenn sich jeder auf den anderen verlassen kann, funktioniert es auch. Der nächste Schritt ist: Kooperation einfordern und durchsetzen. Ich muss sehen, dass die Leute in mein Ruderboot einsteigen, und ihnen die Unterstützung dazu geben. So ein Boot ist ja sehr schmal und schwankend, wir müssen alle lernen, wie wir es zusammen stabilisieren können.
Haben Sie eine spezielle Führungsphilosophie?
Zum einen will ich Vertrauen schaffen. Gegenseitiges Vertrauen ist das Gaspedal, das einer Unternehmung und ihren Mitarbeitenden erlaubt, gemeinsam vorwärtszukommen. Spüren die Mitarbeitenden, dass ihnen vertraut wird, ist dies eine Grundvoraussetzung für «freies» Denken und Handeln im Dienste der eigenen Unternehmung. Das Zweite ist: Wertschätzung zeigen und leben. Bringen Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden Wertschätzung und Respekt entgegen, wird es möglich,
gemeinsam schwierige Probleme und Themen zu meistern.
Was haben Sie während dieser Zeit im Palliativzentrum gelernt?
Meine Strategie am Anfang war: Tun durch Nichtstun. Wenn man neu in einen Betrieb kommt, muss man zuerst sehr gut lauschen, was läuft da, und wie läuft es. Nur durch aufmerksames Zuhören weiss man mit der Zeit, was man verändern kann und was nicht – einen Fluss kann man nicht schieben. Mein Vorgehen war erstens: zuhören, wahrnehmen, lernen; zweitens: Herzen gewinnen; drittens: sich mit der
Zukunft auseinandersetzen. Ziel ist eine sinngebende Führung, das heisst, das Team in den Vordergrund zu stellen und doch in allem
Vorbild zu sein.
Was bedeutet die Auseinandersetzung mit der Zukunft?
Wir sind jetzt sehr gefordert, weil wir uns auf die neuen Abrechnungsmethoden mit den Fallpauschalen vorbereiten müssen. Das heisst, es stehen grosse Investitionen in unsere Infrastruktur, Umstellung des Buchhaltungssystems mit Hardware, Programmen und Schulungen bevor. Der ganze Erfassungsprozess muss neu aufgegleist werden. Wir müssen hier sehen, dass die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt bleiben und sich der ganze Wandel nicht in den Vordergrund zwängt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass das Palliativzentrum Hildegard von einer Stiftung mitfinanziert wird, das heisst, ein Teil der Grundversorgung wird von dieser querfinanziert. Wir finden, es kann ja nicht sein, dass die Sicherstellung der palliativen Versorgung nur durch Stiftungsgelder zu erreichen ist. Das strukturelle Defizit in unserem Unternehmen wird uns noch intensiv beschäftigen.
Welches sind die Ziele für das Palliativzentrum Hildegard?
Wir haben das oberste Ziel gerade festgelegt: Wir streben an, als Betrieb selbstständig zu bleiben. Unsere spezielle Art und Weise – die wollen wir pflegen und weiterentwickeln. An den detaillierten Zielen und der gesamten Strategie arbeiten wir zurzeit sehr intensiv. Besonders wichtig sind uns Kooperationen mit anderen Partnern in der palliativen Versorgungskette. Was inhouse nötig ist, braucht es auch im Grossen: Zusammenarbeit zum Wohl der Patienten. Besonders die mobile Betreuung von Menschen zu Hause muss vorwärtsgehen. Erst wenn die Patienten sagen, etwas Neues sei eine echte Verbesserung, dann können wir von Innovation reden.
Gibt es eine Zukunft für Palliative Care in der Schweiz?
Auf jeden Fall: Erst im August gab es im Zürcher Lighthouse die Gründung eines neuen Verbands: Zehn Hospize mit spezialisiertem, stationärem Palliative-Care-Angebot sind neu unter dem Dachverband «Hospize Schweiz» organisiert. Die neue Kooperation setzt sich für die Förderung des fachlichen Austausches und die Erwirkung von neuen zeit- und aufwandsgerechten Finanzierungsmodellen für Palliativleistungen ein. Palliative Care ist mit massivem Kostendruck verbunden, da immer noch nur ein Teil der Leistungen durch die Krankenkassen gedeckt wird und Hospize auf Spenden und freiwillige Helfer angewiesen sind.
Herr Gassler, Sie treffen viele sehr kranke Menschen in Ihrem Haus. Wie empfinden Sie diese Begegnungen?
Die meisten Patientinnen und Patienten, die hier sind, haben grosse Leiden. Es beeindruckt mich immer wieder, wie Personen damit umgehen. Die meisten entwickeln sehr persönliche Bewältigungsstrategien für ihre Situation. Unser Team unterstützt sie nicht nur mit Medikamenten, sondern auch darin, ihren Haushalt zu regeln, ihr Testament zu machen, alles zu erledigen, was ihnen am Herzen liegt. Die Betreuenden brauchen oft viel Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was Personen am meisten belastet. Die zentrale Frage ist: Was möchte ein Mensch noch machen, wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist? Wir fördern den Aufbau seiner Selbstbestimmung: Jede und jeder kann entscheiden, was, wie und wann sie oder er etwas möchte.
Und bald gibt es auch ein neues Kinder-Palliativzentrum in Basel?
In Deutschland gibt es mittlerweile elf Kinderhospize, bei uns noch kein einziges. Das neue Kinder- und Jugend-Palliativzentrum Basel folgt dem deutschen Modell. Primäre Ziele sind auch hier die Symptomlinderung und die Lebensqualität. Den betroffenen jungen Menschen und ihren Eltern soll es möglichst gut gehen. Die Institution kann ihnen Raum und Zeit für den inneren – und tatsächlichen Abschied bieten. Hier werden die Anliegen und Probleme der ganzen Familie ernst genommen. Da unheilbar erkrankte Kinder sehr viel Betreuung brauchen, kann es sein, dass die Geschwister oft wenig Aufmerksamkeit erhalten. Aber auch für sie ist es eine grosse Hilfe, über die bevorstehenden Prozesse zu sprechen.
Was ist Ihnen ausserhalb des Palliativzentrums wichtig?
Generell möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass in der Gesellschaft ein bewusstes Auseinandersetzen mit schweren Erkrankungen, der letzten Lebensphase und dem Tod stattfindet. Ausserdem war und bleibt die Förderung des Kontakts der Jugend zur Wirtschaft immer ein zentrales Thema für mich. Wir müssen dem fehlenden Nachwuchs nicht nur in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen entgegenwirken, sondern auch im Gesundheitswesen.
Letzte Frage: Welchen Ausgleich hat ein Spitaldirektor zu seiner Arbeit?
Ausgleich ist für mich sehr wichtig, aber die Freude am Job ist bereits ein wichtiger Teil vom Ausgleich für mich. Und sonst: Fasnacht mache ich schon ganz lange. Sie ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Aber nicht im Sinn von Fun und Action – sondern für mich ist sie ein wichtiger Moment, um sich mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Im letzten Jahr habe ich mich mit meinen Basler Bebbi mit dem Thema Mauerbau befasst und eine Veranstaltung mit Vertretern aus acht Religionen organisiert. Weiter lese ich leidenschaftlich Zeitungen und Fachbücher. Ausserdem sehe ich mir gerne Diskussionen am TV an. Ich höre auch viel Radio, weil ich alle Arten von Musik liebe – von Opern über Musicals bis zu Blues. Im Auto drehe immer sehr laut auf, da stört es keinen. Am meisten mag ich Phil Collins, ich bin eben ein typischer 80er-Jahre-Hörer. Ich bin natürlich auch FCB-Fan. Fussball finde ich toll, weil man vom Teamgeist viel lernt. Der Glaube daran, zusammen etwas zu schaffen, verleiht unheimliche Kraft. Ebenfalls koche ich sehr gerne, am liebsten italienisch. Da ich sehr neugierig bin, probiere ich immer wieder neue Rezepte aus. Beim Kochen merkt man, ob man entspannt ist. Ist man hektisch, wird es nichts. An den Wochenenden und in den Ferien koche meistens ich, oft auch mit meinen Kindern, die jetzt zehn, 13 und 17 sind. Das macht sehr grossen Spass. Die Familie ist ein starker Rückhalt für mich.