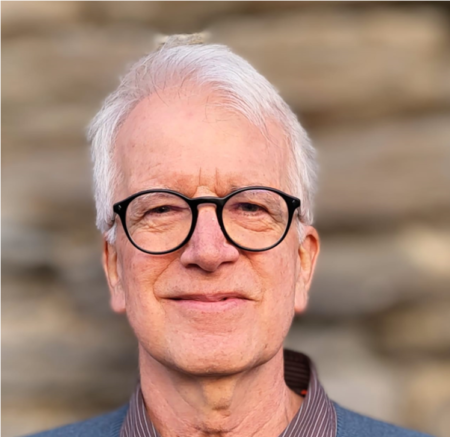Generika, die patentfreien Qualitäts-Arzneimittel, sind auch in der Schweiz zweifellos eine Erfolgsgeschichte, stehen jedoch wegen angeblich im internationalen Vergleich überhöhter Preise vermehrt am Pranger. Der Geschäftsführer des Branchenverbands kritisiert dieses einseitige Bashing und kontert im folgenden Interview.
Sie kennen sicher die Argumentation, Generika-Unternehmen würden das schnelle Geld machen, indem sie nur das Original kopieren.
Diese klischeehafte Behauptung ist schlichtweg falsch. Die patentfreien Qualitäts-Arzneimittel sollten vielmehr als die besseren Medikamente angesehen werden, da sie im Vergleich zu den älteren Originalen mit zum Teil moderneren Methoden entwickelt und hergestellt werden und oft eine verbesserte Galenik (Zubereitung und Herstellung) aufweisen. Und das noch zum günstigeren Preis! Daher sind wir die Guten in der Gesundheitsbranche.
Es geht darum, zum Wohl des Patienten das Präparat noch besser zu machen; auch mit Dienstleistungen, die darum gruppiert sind. Zum Beispiel mit einem Patientenratgeber. Generika stehen auch für Innovation. Nur ein Beispiel von vielen: Man umhüllt die besonders für Kinder ungeeignete, bitter schmeckende Tablette mit einem süssen Überzug. Solche und viele weitere Dienstleistungen würden bei einem reinen Preiswettlauf nach unten, den wir aktuell erleben, wegfallen.
In Auslands-Preisvergleichen versuchen der Preisüberwacher und die Krankenkassen regelmässig aufzuzeigen, dass die Generika-Preise hierzulande um ein Vielfaches höher sind als im Ausland. Welche Argumente halten Sie dagegen?
Diese Preisvergleiche kritisieren wir aufs Schärfste, da sie methodisch falsch sind und Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Gesundheitssysteme sind zu unterschiedlich. Der Preisüberwacher hat ja recht – Generika-Produkte sind in der Schweiz teurer als im Ausland, aber sie sind nicht verantwortlich für den Anstieg der Krankenkassenprämien. Bei jährlichen Gesundheitsausgaben von total 75 Milliarden Franken fallen 6.1 Milliarden Franken auf Medikamente und davon nur 0.63 Milliarden Franken auf Generika. Die Reduktion der Gesundheitsausgaben, wenn Schweizer Generika auf das vom Preisüberwacher genannte Vergleichsniveau sinken würden, wäre 0.42 Prozent. Dies zur Klarstellung der Verhältnismässigkeit.
Die Akteure Ihres Verbandes sind ohne Frage wegen unterschiedlicher Gründe unter Druck. Sie agieren in erster Linie im Hochwährungsland – der Schweiz. Wie gehen diese mit dem Druck um?
Unsere Unternehmen stehen vor der folgenden grossen Herausforderung: Die Kosten werden nach unten reguliert, und dabei hat die Frankenstärke natürlich nicht geholfen. Die Kosten in Franken für Arbeitgeber fallen sowohl bei den Gehaltszahlungen für Arbeitnehmer, aber auch bei den Zulassungsbehörden an. Optimierungsmöglichkeiten sehe ich nur im Einkauf. Wenn die Ware nicht aus der Schweiz ist, bekommt man sie vielleicht bei einem günstigen Qualitätslohn-Hersteller aus dem Ausland.
Und es ist nicht absehbar, dass sich zeitnah die Situation verändert. Im Gegenteil: Der unerwartete Wahlausgang in den USA hat die Verunsicherung an den Märkten verstärkt und zu einem erneuten Aufwertungstrend beim Franken geführt. Das belastet die Unternehmen hierzulande. Das heisst, obwohl die Schweizer Nationalbank im Hintergrund eingreift, wird sich an der Drucksituation wenig verändern. Produziert und entwickelt Ihre Branche zunehmend im Ausland?
Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass Entwicklungs- und Produktionsarbeiten in das europäische Euroland verlagert werden. Arbeitsplatzverluste in der Schweiz sind ein realistisches Szenario. Das ist die eine Komponente. Die andere Schwierigkeit, die noch schwerer wiegt, ist der ständige Kostendruck, mit dem wir in der Generika-Branche konfrontiert sind.
Was heisst das konkret? Nicht wenige Medien sind mit der These auf dem Meinungsmarkt, dass Generika-Unternehmen in der Schweiz viel höhere Preise wie im Ausland verlangen können.
Genau mit dieser Argumentationsfigur sind wir konfrontiert. Uns wird vielfach nachgesagt, dass die Generika mindestens doppelt so teuer wären wie im europäischen Ausland. Hier spielt in erster Linie der Preisüberwacher eine wichtige Rolle, der sehr prononciert in diese Kerbe schlägt. Er ist aber trotzdem auf dem Holzweg.
Das Argument ist falsch?
Da kann ich nur mit einem eindeutigen Ja antworten. Ohne Frage sind die Preise in der Schweiz höher. Das ist aber genau begründbar …
Das sollten Sie dann tun.
Drei zentrale Punkte sind hier wichtig. Erstens ist die Schweiz im Vergleich zu Frankreich oder Deutschland ein sehr kleiner Markt. Sie können daher auch nur kleinere Mengen produzieren und absetzen. Das ist immer eine grosse Herausforderung. Sowohl der Lohnhersteller wie auch die Mitgliedfirmen, die selber produzieren, haben Mühe, kleine Produkteinheiten auf den Schweizer Markt zu bringen. Wenn Sie heute mit den inzwischen verbreiteten neuen High-Speed-Maschinen und Produktionsstrassen Tabletten verpressen und verpacken wollen, dann dauert die Umrüstung der Maschinen länger als die Produktion einer kleinen Charge. Der Aufwand ist höher, und die Firmen verrechnen auch höhere Kosten. Exklusiv für die Schweiz zu produzieren, ist daher immer teurer.
Kommen wir zum zweiten Punkt.
Wenn ein Arzneimittel, welches in der EU, beispielsweise durch das EMA (European Medicines Agency) in London, schon zugelassen ist, muss trotzdem nochmals das ganze Zulassungsprozedere der Schweizer Behörde Swissmedic durchlaufen und separat zugelassen werden. Dies beinhaltet logischerweise weitere Kosten. Diese gliedern sich in direkte Zulassungskosten und eingeforderte Studien auf, die beweisen, dass das Generikum die gleiche Wirkung hat wie das Originalpräparat.
Warum braucht es eine extra Prüfung? Das könnte doch im europäischen Rahmen geregelt werden. Vielleicht braucht es dann im Schweiz-EU-Verhältnis noch den bilateralen Rahmen. Aber das ist in anderen Bereichen doch auch möglich?
Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. Wenn das Präparat von anerkannten Institutionen durchgeprüft wurde, seit einiger Zeit auf dem Markt ist und es zu keinen unerwarteten Nebenwirkungen kommt, braucht es keine nationale Extrawurst. Die zusätzliche nationale Regelung bedeutet einen höheren Zeit- und Kostenaufwand. Diese höheren Kosten werden an den Kunden weitergegeben. Da darf sich dann niemand mehr wundern, dass die Kosten für die Produkte höher wie im Ausland sind. Da wäre eine erleichtere Zulassung möglich, und wir könnten eine signifikante Senkung der Preise verkünden.
Und der dritte Punkt?
Dann haben wir den Anspruch unserer Kunden auf dem Aufmerksamkeitsschirm, sie sollen zwischen allen möglichen Packungsgrössen und Darreichungsformen auswählen dürfen. Das ist ein weiterer Kostentreiber in der Kostenstruktur.
Der Kunde soll, ohne Abstriche seine Wunschpackung bekommen. Man kann die Kosten- und Preissituation aber gerade auch wegen dieses Sonderaufwandes nicht mit anderen Generika-Märkten in Europa vergleichen. Dort bestimmen beispielsweise Krankenkassen, wenn sie mit einer Firma einen Vertrag abgeschlossen haben, welches Präparat gegen Bluthochdruck Frau Meyer im August und im November bekommt. Das können unterschiedliche Unternehmen sein, je nachdem, welche Firma einige Cent billiger ist.
Es gibt, lassen Sie mich das zusammenfassen, aus Ihrer Sicht unsinnige Regulierungsvorgaben, die Zeit und Geld kosten. Ich hake jetzt nochmals kritisch nach. Eigentlich sind die Kosten im Gesundheitswesen seit Ende der Neunzigerjahre um das Doppelte gestiegen. Ich lese oft Beiträge, in dem es um die Kostenexplosion im Gesundheitswesen geht, und auch viele Medikamente werden immer teurer. Es gibt jetzt konkrete Vorschläge, die in die Richtung gehen, nicht mehr Marken, sondern Wirkstoffe zu bezahlen. Wie sieht Ihre Positionierung hier aus?
Ein Medikament ist weit mehr als nur ein Wirkstoff, wie ich vorgängig erläutert habe. Aus diesem Grund wehren wir uns gegen ein Billigstprinzip. Der Bundesrat möchte 2019 ein sogenanntes Referenzpreis- beziehungsweise Festbetragssystem einführen. Das ist aus unserer Sicht eine falsche Entscheidung. Im Rahmen dieses Systems würde dem Patienten immer nur das billigste Medikament verschrieben werden, und die Wahlfreiheit der Ärzte, Apotheker und Patienten würde wegfallen. Diverse Studien belegen, dass diese Anspruchsgruppen allesamt gegen den Systemwechsel sind und dieser nur Verlierer hervorbringen würde. Zudem würde ein Billigstprinzip in der Schweiz dazu führen, dass nur grosse Anbieter überleben würden. Alle anderen laufen Gefahr, aus dem Markt auszuscheiden.
Da sehen Sie oligopolistische Strukturen am Horizont?
Mehr noch, der Trend zur Duo- oder Monopolisierung wäre gegeben.
Das will begründet sein.
Schon heute operieren einige Hersteller teilweise nicht kostendeckend. Bei einem weiter verschärften Preisdruck werden sich mehr und mehr Hersteller aus diesen nicht rentablen Geschäften zurückziehen und sich profitableren Segmenten zuwenden, was zu einer Markverengung und schlussendlich zu Lieferengpässen führen wird. Das ist ein Zustand, den sich viele Menschen heute nicht vorstellen können. Diese Versorgungssicherheit ist aber dann gefährdet – und keinesfalls Gott gegeben.
Für gewisse Antibiotikasegmente und auch bei Darreichungsformen im pädiatrischen Bereich stehen Medikamente schon heute nicht mehr zur Verfügung. Die Kinderärzte oder die Verantwortlichen müssen improvisieren und sich im Ausland umschauen. Sie gehen dann oft auch dazu über – und das ist fatal –, sich ein teureres Originalpräparat zu beschaffen, um die Krankheit zu therapieren.
Das brauche ich jetzt noch etwas konkreter. Generikamedikamente sind in der Schweiz bei einem Marktanteil von 15 Prozent, was den Medikamentenumsatz betrifft. Da ist ja noch viel Luft nach oben?
Ja, aber Generika sollten gefördert und nicht boykottiert werden. Statt Generika unqualifiziert und undifferenziert zu attackieren, sollten die patentfreien Qualitätsarzneimittel durch umfassende Anstrengungen von allen Beteiligten gefördert werden. Mit Einsparungen von einer Milliarde Franken pro Jahr leisten Generika heute schon einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Kostenanstiegs im Gesundheitswesen Die Politik ist gefordert, bessere Rahmenbedingen für Generika zu schaffen. Wir brauchen mindestens die gleich langen Spiesse. Zudem sollten die Anreizsysteme neu justiert werden.
Können Sie uns dazu ein Beispiel verraten?
Ein Arzt oder Apotheker hat die Wahl, ein Original- oder ein Generikum abzugeben. Wenn er das Original verkauft, verdient er mehr, da die Marge höher ist als beim vergleichbaren Generikum. Ein ökonomisch denkender Arzt oder Apotheker wird bestraft, wenn er ein Generikum abgibt. Es kann ja nicht sein, dass Generika so in den Schatten gestellt werden, und alle, die sparsam ökonomisch handeln wollen, die Dummen sind. Wann handelt hier die Politik? Es muss eine gleiche Marge für die gleiche Dienstleistung her.
Klingt eigentlich logisch. Die Pharma-Lobby gilt in Bern als gut vernetzt. Warum kommen Sie damit in der Hauptstadt nicht durch?
Es hakt am politischen Willen, hier eine rasche Lösung zu finden. Der Auftrag bei Intergenerika ist, zusammen mit den Apothekern und der Ärzteschaft, dabei in Bern bei den verantwortlichen Gremien Druck aufzubauen. Statt nur einseitig die Diskussion an den Preisen aufzuhängen und dabei die von Generika erbrachten Leistungen völlig auszuklammern, sollte die Politik zusammen mit allen Anspruchsgruppen konzertiert daran arbeiten, die Rahmenbedingungen für Generika zu verbessern.
Wie denken Sie, dass sich Ihre Branche in den nächsten Jahren entwickelt?
Wenn es zu weiteren Preissenkungen kommt und die Situation sich verschärft, werden wie gesagt nur wenige Firmen übrig bleiben. Die Grossen werden die Angriffe überleben. Alle anderen sind gefährdet. Dieser Tendenz müssen wir absolut entgegentreten. Was wir brauchen, ist ein gesunder Wettbewerb untereinander. Firmenverantwortliche brauchen Anreize, damit sie Innovationen auch im kleinen Rahmen realisieren können und darüber hinaus die Versorgungsqualität und -sicherheit gewährleistet bleiben.
Weitere Informationen:
www.intergenerika.ch